
Einzeltitel
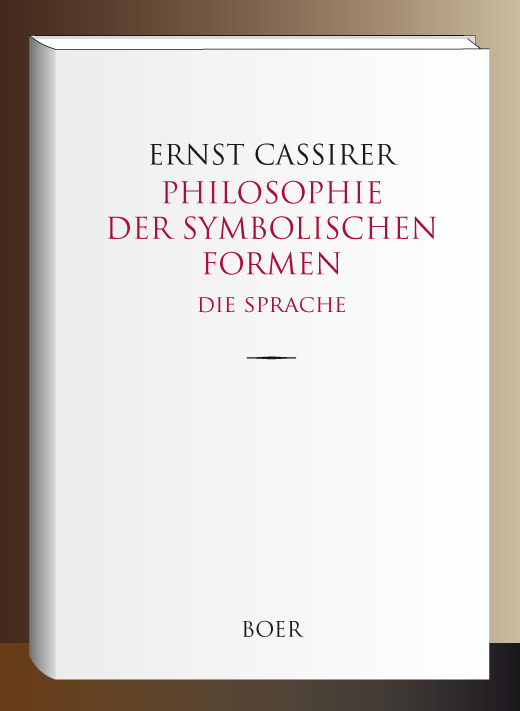
Ernst Cassirer
Philosophie der symbolischen Formen
Erster Teil: Die Sprache
348 Seiten, Hardcover mit Schutzumschlag
Mit 1 Abbildung
Format: 13,5 x 21,5 cm
Euro 44,00 [D]
ISBN 978-3-96662-516-6
LIEFERBAR
Cassirers Grundlagenwerk zur Philosophie der Sprache
Zum Text
Die Schrift, deren ersten Band ich hier vorlege, geht in ihrem ersten Entwurf auf die Untersuchungen zurück, die in meinem Buche »Substanzbegriff und Funktionsbegriff« (Berlin 1910) zusammengefaßt sind. Bei dem Bemühen, das Ergebnis dieser Untersuchungen, die sich im wesentlichen auf die Struktur des mathematischen und des naturwissenschaftlichen Denkens bezogen, für die Behandlung geisteswissenschaftlicher Probleme fruchtbar zu machen, stellte sich mir immer deutlicher heraus, daß die allgemeine Erkenntnistheorie in ihrer herkömmlichen Auffassung und Begrenzung für eine methodische Grundlegung der Geisteswissenschaften nicht ausreicht. Sollte eine solche Grundlegung gewonnen werden, so schien der Plan dieser Erkenntnistheorie einer prinzipiellen Erweiterung zu bedürfen. Statt lediglich die allgemeinen Voraussetzungen des wissenschaftlichen Erkennens der Welt zu untersuchen, mußte dazu übergegangen werden, die verschiedenen Grundformen des »Verstehens« der Welt bestimmt gegen einander abzugrenzen und jede von ihnen so scharf als möglich in ihrer eigentümlichen Tendenz und ihrer eigentümlichen geistigen Form zu erfassen. [Aus dem Vorwort]
Der Text des vorliegenden Neusatzes folgt der Ausgabe von 1923, erschienen im Verlag Bruno Cassirer, Berlin.
Zum Autor

Ernst Cassirer (1874-1945) forschte und lehrte zunächst in Berlin, ab 1919 als Philosophieprofessor an der Universität Hamburg. 1933 wurde ihm als Juden dort der Lehrstuhl entzogen. Im selben Jahr verließ er das nationalsozialistische Deutschland und ging zunächst nach Großbritannien ins Exil, wenig später nach Schweden, wo er 1939 schwedischer Staatsbürger wurde, 1941 schließlich in die USA. In der Emigration war er Gastprofessor in Oxford, anschließend Inhaber eines philosophischen Lehrstuhls in Göteborg und später Professor an der Yale-Universität und an der Columbia-Universität in New York. Die Philosophie Ernst Cassirers wird einerseits dem naturwissenschaftlich orientierten Neukantianismus der Marburger Schule zugeordnet. Über die Kategorie der symbolischen Formen und Themen der Sprachphilosophie nahm Cassirer aber auch Denkströmungen des 20. Jahrhunderts auf und formulierte eine eigenständige Kulturphilosophie, die im vorliegenden Band seine deutlichste Ausprägung findet. [Bildquelle: Wikipedia]
Inhalt:
Einleitung und Problemstellung
1. Der Begriff der symbolischen Form und die Systematik der symbolischen Formen
2. Die allgemeine Funktion des Zeichens. – Das Bedeutungsproblem
3. Das Problem der »Repräsentation« und der Aufbau des Bewußtseins
4. Die ideelle Bedeutung des Zeichens. – Die Überwindung der Abbildtheorie
Erster Teil: Zur Phänomenologie der sprachlichen Form
Kapitel I: Das Sprachproblem in der Geschichte der Philosophie
1. Das Sprachproblem in der Geschichte des philosophischen Idealismus (Platon, Descartes, Leibniz)
2. Die Stellung des Sprachproblems in den Systemen des Empirismus (Bacon, Hobbes, Locke, Berkeley)
3. Die Philosophie der französischen Aufklärung (Condillac, Maupertuis, Diderot)
4. Die Sprache als Affektausdruck. – Das Problem des »Ursprungs der Sprache« (Giambattista Vico, Hamann, Herder, Die Romantik)
5. Wilhelm von Humboldt
6. August Schleicher und der Fortgang zur »naturwissenschaftlichen« Sprachansicht
7. Die Begründung der modernen Sprachwissenschaft und das Problem der »Lautgesetze«
Kapitel II: Die Sprache in der Phase des sinnlichen Ausdrucks
1. Die Sprache als Ausdrucksbewegung. – Gebärdensprache und Wortsprache
2. Mimischer, analogischer und symbolischer Ausdruck
Kapitel III: Die Sprache in der Phase des anschaulichen Ausdrucks
1. Der Ausdruck des Raumes und der räumlichen Beziehungen
2. Die Zeitvorstellung
3. Die sprachliche Entwicklung des Zahlbegriffs
4. Die Sprache und das Gebiet der »inneren Anschauung«. – Die Phasen des Ichbegriffs
Kapitel IV: Die Sprache als Ausdruck des begrifflichen Denkens. – Die Form der sprachlichen Begriffs- und Klassenbildung
1. Die qualifizierende Begriffsbildung
2. Grundrichtungen der sprachlichen Klassenbildung
Kapitel V: Die Sprache als Ausdruck der logischen Beziehungsformen. – Die Relationsbegriffe
Als PDF downloaden:
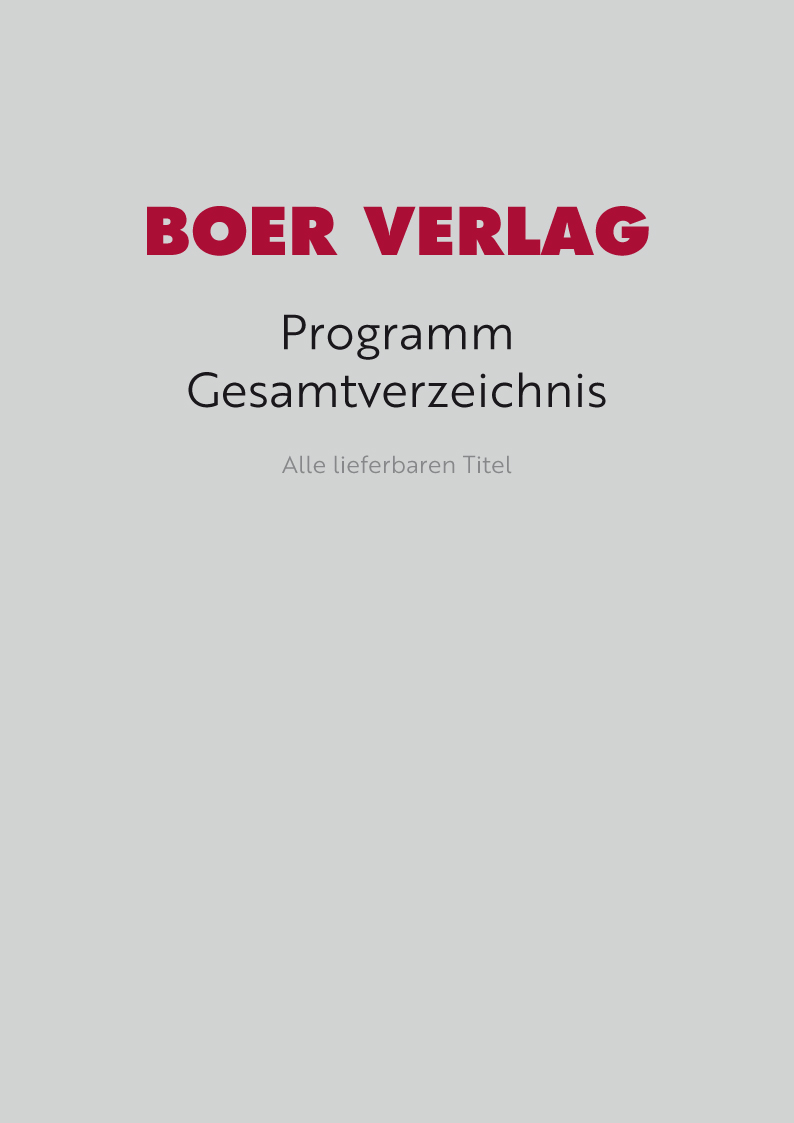
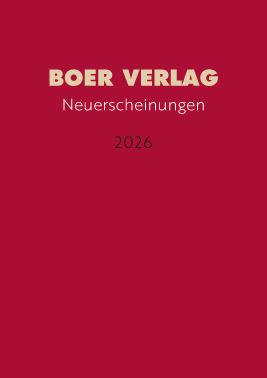
Gesamtverzeichnis
Neuerscheinungen 2026
Freunde von guten Büchern finden uns auch auf Facebook: 
Sie suchen ein bestimmtes Buch?
Alle Autoren, auch solche in Sammelbänden, sowie Herausgeber, Übersetzer und Illustratoren sind hier oder unter dem Menu Autoren mit den dazugehörigen Titeln gelistet.
Lieferstatus
- Der nebenstehende Titel ist als Book On Demand (BoD) - Buchdruck auf Anforderung - über jede Buchhandlung und jeden Internetbuchhändler lieferbar.
- Natürlich können Sie das Buch auch direkt beim Verlag bestellen.
- Am einfachsten: Sie clicken auf den KAUFEN-Button und werden direkt zum BoD-Buchshop mit dem gewählten Titel geleitet.
Von Cassirer ist außerdem erschienen:
Klassiker der Philosophie
- Marc Aurel, Selbstbetrachtungen
- George Berkeley, Abhandlung über die Prinzipien der menschlichen Erkenntnis
- Fichte, Die Bestimmung des Menschen
- Sigmund Freud, Das Unbehagen in der Kultur
- David Hume, Eine Untersuchung über den menschlichen Verstand
- David Hume, Dialoge über natürliche Religion
- Kant, Zum ewigen Frieden
- Pico della Mirandola, Ausgewählte Schriften
- Rousseau, Bekenntnisse
